Red. – Dieser Beitrag erschien zuerst in der «Berliner Zeitung».
_____________________
Die Covid-19-Pandemie hat tief in das Leben aller Menschen eingegriffen – wobei dieser Eingriff nicht nur durch die Infektionskrankheit selbst, sondern auch durch die Massnahmen der Regierung erfolgte. Die Herausforderungen durch die schnelle, weltweite Verbreitung eines neuen, für einige Bevölkerungsgruppen sehr gefährlichen Virus waren enorm und mussten von den politischen Verantwortlichen gemeistert werden.
Wenn heute eine Aufarbeitung der damaligen Vorgänge gefordert wird, sollte das vorrangige Ziel dabei sein, Lehren für den gesellschaftlichen Umgang mit grossen Infektionsausbrüchen (z.B. durch Influenzaviren) zu ziehen, die auch in der Zukunft nicht auszuschliessen sind. Selbstverständlich sollte es aber auch darum gehen, als fehlerhaft erkannte Entscheidungen zurückzunehmen, wenn dies noch möglich ist.
Bei der öffentlichen Diskussion der staatlichen «Corona-Massnahmen» dominieren gegenwärtig zwei Fragen:
Welche der Massnahmen haben die Übertragung des Virus wirksam reduziert, und welche der Massnahmen waren in dieser Hinsicht wenig wirksam oder sogar wirkungslos?
Wie war das Verhältnis von gesundheitlichem Nutzen und kollateralen Schäden der Massnahmen, zum Beispiel in Bezug auf die physische und psychische Gesundheit, auf Wirtschaft, Kultur und die freiheitlich-demokratische Gesellschaft insgesamt?
Für eine umfassende Analyse sollten jedoch zwei weitere Punkte hinzukommen:
Erstens: War wirklich die Reduktion der Virusübertragung am wichtigsten, oder sollte nicht eher die Reduktion der Krankheitslast für die Bevölkerung das Ziel gewesen sein?
Zweitens: Waren ab einem bestimmten Zeitpunkt des mehrjährigen Infektionsgeschehens sogar die «wirksamen» Massnahmen zumindest für junge und gesunde Menschen unnötig, weil sie die Ausbildung einer notwendigen Gruppenimmunität in der Bevölkerung verzögerten und damit das Pandemie-Geschehen eher verlängerten?
Eigentlich gibt es Regeln zum Umgang mit Seuchenausbrüchen
Die Bekämpfung neu auftretender Infektionskrankheiten erfolgt in einem abgestuften Prozess mit den drei Kernelementen:
1. Containment (Eindämmung)
2. Protection (Schutz der Vulnerablen)
3. Mitigation (Folgenminderung).
In der ersten Phase des Ausbruches wird eine Eindämmungsstrategie verfolgt mit dem Ziel, die weitere Ausbreitung des Erregers von den primären Ausbruchsorten so weit wie möglich zu verhindern oder wenigstens noch zu verlangsamen.
Da sich bei Pandemien die Verbreitung nicht komplett stoppen lässt, muss man gleichzeitig auch den Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen (bei Covid-19 sind dies insbesondere alte und vorerkrankte Menschen) beginnen (Protection), der dann zum zentralen Bestandteil der Bekämpfung werden sollte, wenn die Verlangsamung der Ausbreitung nicht mehr ausreichend gelingt. Das Containment wird schrittweise wirkungslos nach der einsetzenden freien Zirkulation des Erregers, weil die Infektionsketten nicht mehr wirksam nachzuverfolgen sind.
Die Autoren dieses Artikels
Professor Dr. med. Detlev H. Krüger war von 1989 bis 2016 Direktor des Instituts für Virologie der Charité Berlin. Er wirkte gleichzeitig viele Jahre unter anderem als Vorstand der Gesellschaft für Virologie, Stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Paul-Ehrlich-Instituts (Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel) sowie als Editor-in-Chief der Fachzeitschrift „Virus Genes“ (Verlag Springer-Nature, New York).
Professor Dr. Klaus Stöhr arbeitete von 1992 bis 2007 im Hauptquartier der WHO in Genf unter anderem als Koordinator der globalen Sars-Forschung, als Pandemiebeauftragter der WHO und leitete über viele Jahre das Globale Influenzaprogramm der WHO. Sein internationales Team entdeckte das Sars-CoV-1-Virus. Ab 2007 arbeitete er in der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen bei Novartis und später in der Firmenzentrale in Basel. Seit 2018 ist er freier Konsultant.
Während des gesamten Ausbruches muss eine Folgenminderungsstrategie (Mitigation) Teil der Überlegungen sein, um die gesundheitlichen Auswirkungen des Infektionsgeschehens so weit wie möglich zu minimieren und gleichzeitig die Kollateralschäden für die Gemeinschaft und das soziale Leben möglichst gering zu halten. Unbekannt waren diese Prinzipien des Seuchenschutzes nicht; wurden sie doch noch am 13. Februar 2020 im Epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts bekräftigt.
Dass das Containment auch noch im Winter 2020/21 aufrechterhalten wurde, obwohl die Ausbreitung gar nicht mehr effizient verlangsamt werden konnte, war vielleicht noch verständlich, da der Impfstoff noch nicht zur Verfügung stand. Aber auch in den Folgemonaten und -jahren konnte man sich nicht entschliessen, das massive Containment aufzugeben, und hat die Kollateralschäden der Massnahmen für die Gesellschaft billigend in Kauf genommen.
Trugschluss Zero Covid
Mehr noch, in der Politikberatung durch «die» Wissenschaft setzte sich eine gefährliche Meinung durch: Basierend auf theoretischen Modellrechnungen wurde postuliert, man könne die Infektionsrate entscheidend senken oder das Virus sogar «ausrotten», wenn man die Containment-Massnahmen nur einmal richtig verschärfen würde; danach könne man mit geringem Aufwand die Infektionsrate weiter niedrig halten oder sogar gegen Null bringen (Zero-Covid).
Diese Idee beruhte jedoch auf einem Trugschluss: Da sich so keine Immunität in der Bevölkerung entwickeln könnte, würde jede «Lockerung» des strengen Regimes sofort zu einem rasanten Wiederaufflammen des Infektionsgeschehens führen. Dies haben auch die Vorgänge in China nach Beendigung der massiven Freiheitsbeschränkungen gezeigt.
Jeder Verweis auf die etablierten Methoden zur Seuchenbekämpfung wurde reflexartig als Infragestellen der Massnahmen und ihrer Sinnhaftigkeit gewertet und zog einen medialen Sturm der Entrüstung nach sich.
Dabei war von Anfang an klar, dass zum Beispiel das Infektionsrisiko an frischer Luft äusserst gering ist (man brauchte also eigentlich keine Senioren von Parkbänken zu verjagen oder den Kindern ihre Spielplätze zu sperren), dass bei rapider Infektionsausbreitung die sogenannte «Kontaktnachverfolgung» durch überlastete Gesundheitsämter nicht zu schaffen ist (und diese Ressourcen nicht nur bei der Umsetzung der Hygienekonzepte in den Alten- und Pflegeheimen fatal fehlen würden), oder dass das Coronavirus als Atemwegsvirus nicht durch Desinfektion von Tischen in Gaststätten bekämpft werden kann. Die Liste der Beispiele liesse sich beliebig fortsetzen.
Dass entsprechend den Regeln des Seuchenschutzes vor allem die Vulnerablen geschützt werden müssten (Protection/Mitigation), wurde nicht akzeptiert – die Vulnerablen sollten im Zuge eines allgemeinen Lockdowns der Gesellschaft gewissermassen «mitgeschützt» werden.
Der allgemeine Lockdown (also ein «Dauer-Containment») besonders in den Sommermonaten hatte aber nicht nur die bekannten tragischen Konsequenzen für die Gesellschaft, sondern führte auch dazu, dass zum Beispiel die Winterpeaks noch stärker wurden, weil sich die gegen das Virus schützende Immunität besonders bei den Kindern nur verlangsamt ausbildete.
Das Virus passte sich an den Wirt an und wurde infektiöser, aber harmloser
Alle Viren machen bei ihrer Vermehrung in der Wirtszelle «Fehler», ihr Erbmaterial erleidet Veränderungen (Mutationen). Ob sich die neuen genetischen Varianten (Mutanten) in der Umwelt durchsetzen, hängt davon ab, ob sie besser als ihre Vorgänger vermehrungsfähig sind und der Immunabwehr des Wirts entgehen.
Bei Wechsel eines Virus vom Tier auf den Menschen werden sich also solche Mutanten durchsetzen, die sich besonders gut an die Vermehrung im Menschen angepasst haben. Das Virus wird damit «infektiöser» und breitet sich in der Bevölkerung effizienter aus, gleichzeitig ist es für den neuen Wirt in der Regel weniger krankmachend. Deshalb bestand von Anfang an die berechtigte, aber leider weitgehend unberücksichtigte Forderung, die Gefährlichkeit des Virus und des Infektionsgeschehens nicht an der «Infektionsinzidenz», sondern an der wirklichen Krankheitslast in der Bevölkerung festzumachen.
Stattdessen wurde jeder Nachweis von neuen Virusmutanten in Patienten (oder sogar im Abwasser) in den Medien kolportiert und der Bevölkerung als Begründung für die Aufrechterhaltung oder sogar Verschärfung der «Corona-Massnahmen» präsentiert: Berater der Bundesregierung sind in diesen Tenor mit eingefallen.
Spätestens das Auftreten der Omikron-Varianten des Virus ab Anfang 2022 ging aber mit einer deutlich geringeren Krankheitslast der Coronavirusinfektion für den Menschen einher. Die sich effizient in der Bevölkerung ausbreitenden Omikron-Varianten haben dazu geführt, dass eine Infektion grösserer Bevölkerungsgruppen mit einem geringeren Anteil von schweren klinischen Fällen auftrat. Dies resultierte in der natürlichen «Durchimmunisierung» breiter Teile der Bevölkerung – und führte damit zum Ende des herausragenden Infektions- und Krankheitsgeschehens der Pandemie und zum schrittweisen Übergang in das gegenwärtige endemische Geschehen.
Das Sars-Coronavirus-2 wird, genau wie die bereits beim Menschen zirkulierenden weiteren Coronaviren, auch in Zukunft für einen Teil der jährlichen Atemwegsinfektionen verantwortlich bleiben. Wir werden mit ihm leben können, so wie wir mit vielen anderen Viren leben.
In dieser Situation wurde übrigens erneut deutlich, wie wichtig eine Unterscheidung zwischen «an Corona» und «mit Corona» Erkrankten oder sogar Verstorbenen gewesen wäre, die leider nicht erfolgt ist: Durch Infektion mit dem sich effizient ausbreitenden Virus waren viele Patienten, die wegen Verkehrsunfall, Herzinfarkt oder aus vielen anderen medizinischer Gründe in die Klinik kamen, beim Routinetest positiv für Corona gefunden worden und gingen als «Covid-19-Fälle» in die Statistik ein, ohne dass die Infektion ursächlich für die Hospitalisierung oder gar den Tod war. Über die Verzerrung der Statistiken kann man nur spekulieren.
Die Impfung – entwicklungstechnische Tempoleistung und Politikum
Die Entwickler der schnell fertiggestellten Impfstoffe zielten darauf ab, die Zahl schwerer Krankheitsverläufe zu reduzieren. Dies war für ältere und vorerkrankte Personen von grosser und zum Teil lebensrettender Bedeutung. Die Verhinderung von Re-Infektionen oder gar der Virusausscheidung nach Infektion waren keine erreichbaren Zielstellungen für die Impfstoffentwicklung.
Es war immer klar, dass die Impfung die Weitergabe des Virus von Mensch zu Mensch nicht entscheidend zu blockieren vermag: Die Impfung führt also zu einem gewissen Eigenschutz des Geimpften gegenüber der Erkrankung, nicht aber zu signifikantem Fremdschutz. Ursache dafür ist, dass ein injizierter Impfstoff nicht zur sterilen Immunität führt, da er wegen der Umgehung des Atmungstraktes keine ausreichende Schleimhaut-Immunität erzeugen kann.
Dennoch wurde das Thema Impfung politisch massiv aufgeladen und jeder Mensch, der die wiederholte Impfung ablehnte (aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel wegen schwerer Nebenwirkungen bei der Erstimpfung) mit Begriffen wie «unsolidarischer Pandemietreiber» diskreditiert. Gleichzeitig wurde massiver Impfdruck aufgebaut, beispielsweise durch die noch gut bekannte «2G (Geimpft/Genesen)-Regelung» als Voraussetzung zur Teilnahme am öffentlichen Leben.
Rhetorisch fokussierte sich die Politik unverständlicherweise nicht auf die von der Impfung profitierenden Älteren und Vulnerablen, sondern besonders auf die Menschen, für die die Impfung nur einen marginalen gesundheitlichen Nutzen hatte: Jugendliche und junge Erwachsene. Behauptet wurde auch, dass die Impfung die Virusweitergabe «viel besser» verhindere als die durchgemachte Infektion (also der Status «Genesen»), obwohl jeder Medizinstudent lernt, dass die Vielfalt und Zusammensetzung der Proteinabschnitte des kompletten Virus im Organismus eine umfassendere Immunantwort hervorruft, als ein einzelnes Protein dies vermag.
Seit den alten Griechen ist bekannt, dass Arzneimittel Nebenwirkungen haben. Nicht umsonst bedeutet das Wort «Pharmakon» Arzneimittel und Gift zugleich. Trotz gegenteiliger Behauptungen fachfremder Politiker (wie auch von «Experten») war also von Anfang an klar, dass die Impfstoffe nicht «nebenwirkungsfrei» sein können. Heute fühlen sich viele Patienten mit Impfschäden alleingelassen, da sie den Eindruck haben, dass ihre Probleme nach dem Prinzip «Weil nicht sein kann, was nicht sein darf» ignoriert werden. So wie es dringend notwendig ist, die Ursachen von Langzeitfolgen nach der Covid-19-Erkrankung (Long Covid) besser zu verstehen und den Patienten wirksamer zu helfen, sollte dies ganz genauso für die Patienten mit Impfkomplikationen (PostVac-Syndrom) gelten.
Kinder: vom Virus wenig betroffen, aber umso mehr durch die Massnahmen
Bei Kindern verläuft die Infektion mit dem Sars-Coronavirus-2 in der Regel ohne Symptome oder nur mit leichter Erkrankung. Glücklicherweise sind schwere Verläufe sehr, Todesfälle durch die Infektion gar extrem selten. Anders als bei Infektionen mit dem Influenzavirus, bei denen Kinder eine Risikogruppe für schwere Erkrankungen darstellen, ist dies für das Coronavirus nicht der Fall.
All diese Tatsachen waren schon Anfang 2020 durch das Berichtsystem der Kinderkliniken und Daten aus China bekannt. Spätestens Ende 2020 lagen dazu auch solide Daten aus Deutschland vor und es war zudem klar, dass Kindergärten und Schulen keine «Hotspots» der Virusausbreitung waren, sondern Infektionen hier eher durch Erwachsene hineingetragen wurden.
Dennoch wurde kaum eine andere Bevölkerungsgruppe stärker mit Corona-Massnahmen überzogen. Kinder haben durch Isolation, Mangel an sozialer Teilhabe und Bildungsdefizite grossen Schaden genommen, psychische und körperliche Erkrankungen sind bei ihnen deutlich angestiegen.
Es war befremdlich zu erleben, dass kaum eine staatliche Organisation oder Lehrergewerkschaft, die dem Schutz der Kinder verpflichtet sein sollten, sich für deren Interessen einsetzte. Auch die Justiz tat es selten: So wurde die von einem der Autoren gutachterlich unterstützte Klage von Berliner Eltern auf Schulöffnung im Frühjahr 2021 vom Verwaltungsgericht zurückgewiesen.
Als letztes Argument für Schulschliessungen und all die anderen restriktiven Massnahmen wurde angeführt, dass infizierte Kinder zwar kaum selbst erkranken, aber doch ihre Grosseltern gefährden könnten. Das Einfordern einer «Solidarleistung» der Kinder lag auch dem Ansinnen zugrunde, an Kindern Corona-Impfungen vorzunehmen.
Dies war nicht nur sachlich schwer begründbar, sondern auch moralisch fragwürdig: Bei der Nutzen-Risiko-Abwägung für die durch das Virus kaum gefährdeten Kinder überwiegt das Risiko durch die Anwendung von nur kurz erprobten, bedingt zugelassenen Impfstoffen. Und selbst wenn es berechtigt wäre, von den Kindern eine «Solidarleistung» für die Gesellschaft zu verlangen: Die Impfung schützt gar nicht effektiv vor Virusweitergabe.
Warum endete die Pandemie?
Die Ausbreitung eines neuen, hochinfektiösen Virus wird begrenzt, wenn ein genügend grosser Anteil der Bevölkerung gegen dieses Virus eine solche Immunität entwickelt hat, die die Weitergabe des Virus verhindert oder erschwert – wodurch Infektionsketten unterbrochen werden. Es entwickelt sich dann ein sogenanntes endemisches Geschehen: Da die Immunität nicht alle Personen umfasst und in ihrer Stärke und Dauer Veränderungen unterliegt, zirkuliert das Virus auf niedrigem Niveau dauerhaft weiter, mit den bekannten saisonalen Peaks im Winter.
Die Re-Infektionen verlaufen dann in der Regel viel milder, bleiben häufiger unentdeckt, können aber selten – besonders bei Vulnerablen – auch schwer verlaufen. Ein solches endemisches Geschehen existiert für Infektionen durch andere humane Corona- oder Atemwegsviren schon seit langem.
Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte stand während einer Pandemie ein Impfstoff in grossem Massstab zur Verfügung. Damit konnten schwere Krankheitsverläufe besonders bei den Vulnerablen oft vermieden und sicherlich auch viele Todesfälle verhindert werden. Eine ausreichende Immunität zum Übergang von der Pandemie mit den weit verbreiteten Ausbrüchen und schweren Verläufen in der Bevölkerung zur sogenannten Endemie konnte im Falle von Covid-19 allein durch die Impfung aber nicht wirksam erreicht werden, sondern es bedurfte auch der natürlichen Infektion mit dem Virus.
Die Corona-Pandemie endete für Deutschland nicht durch staatliche «Lockdown-Massnahmen», sondern – im Gegenteil – weil das Virus schlussendlich einen Grossteil der Bevölkerung infizierte. Diese Virusausbreitung in der Bevölkerung vollzog sich glücklicherweise ohne extreme Krankheitslast für die Menschen: Mit dem Auftreten der Omikron-Virusvarianten, die gegenüber den primären Varianten des Sars-Coronavirus-2 eine abgeschwächte Krankheitslast bedingten, sowie durch die bereits erfolgte Impfung grosser Teile der krankheitsanfälligen Risikogruppen verlor das Virus weitgehend seine Schrecken.
Dass man 2020 in der bedrohlichen Situation am Anfang der Pandemie mit möglichst vielen Mitteln die Ausbreitung des Virus und die Überlastung der Kliniken zu verhindern suchte, war richtig und verständlich. Danach hätte man sich aber schneller auf an die Situation angepasste und wirklich wirksame Massnahmen zur Protection/Mitigation konzentrieren müssen, um die massiven gesellschaftlichen Kollateralschäden abzumildern. Die sture Weiterführung der Massnahmen bis in das Jahr 2023 führte lediglich (soweit eine Reduktion der Übertragung des Virus bewirkt wurde) zu einer verzögerten Ausbreitung der für das Ende der Pandemie notwendigen Immunität in der Bevölkerung.
Fazit
Auch in der Zeit der Corona-Krise gab es nicht «die» eine Wissenschaft, die der Politik eindeutige Handlungsempfehlungen geben konnte, sondern ein Spektrum wissenschaftlicher Meinungen. Unverständlich bleibt, wieso das etablierte Wissen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten nicht nur von den tonangebenden Grundlagenwissenschaftlern und Politikberatern negiert wurde, sondern auch die Meinung von Fachgesellschaften (wie z.B. der Hygiene und der Kinder- und Jugendinfektiologie) in den Wind geschlagen wurde.
Wissenschaft lebt vom freien Austausch der Erkenntnisse und Ansichten; sie erleidet Schaden, wenn dieser Austausch mit der Behauptung einer «Alternativlosigkeit» und der Suggestion einer absoluten Wahrheit eingeengt werden soll.
Der wissenschaftliche Diskurs in der Corona-Zeit war keinesfalls zu breit oder gar «verwirrend», sondern wurde in Allianz mit Politik und Medien sehr einseitig dominiert. Es gibt deshalb zur Besorgnis Anlass, wenn nun von einzelnen Wissenschaftlern in Deutschland ein «wissenschaftliches Sprechmandat in der Öffentlichkeit» gefordert wird oder im geplanten «Pandemieabkommen» der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine «effektive Informationskontrolle zur Bekämpfung von Fehl- und Desinformationen» angestrebt wird.
Heute ist leider klar, dass etliche der in den Corona-Jahren von der Politik verordneten (und von «der» Wissenschaft wärmstens empfohlenen) Massnahmen entweder unnötig waren oder mehr Schaden als Nutzen gestiftet haben. Es würde sicherlich dem gesellschaftlichen Frieden dienen, wenn die wegen Verstosses gegen Corona-Vorschriften ausgesprochenen Strafen und Berufsverbote für die betroffenen Mitbürger noch einmal überprüft würden.
Was tun bei möglichen zukünftigen gefährlichen Pandemien? Hier einige Vorschläge: Schaden und Nutzen der einzelnen Massnahmen besser gegeneinander abwägen; Erhebung der relevanten Daten zur Einschätzung des Infektionsgeschehens und der Krankheitslast; evidenzbasierte Entscheidungen statt Abhängigkeit von der Deutungshoheit medienaffiner Politiker; Politikberatung durch eine breitere Gruppe von Experten verschiedener Wissens- und Erfahrungsgebiete; sachliche Information der Bevölkerung statt Schüren von Angst und Hysterie. Auch Pandemien dürfen den Rechtsstaat nicht ausser Kraft setzen.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.
Weiterführende Informationen

:focal(718x465:719x466)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/10/Uster_Baar.jpg)
:focal(50x50:51x51)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/06/zentralplus-redaktion.png)

:focal(450x253:451x254)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/04/gemeinde_emmen.jpg)
:focal(1031x704:1032x705)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2023/09/thomas_aeschi_nationalrat_zug-e1696081544103.jpg)


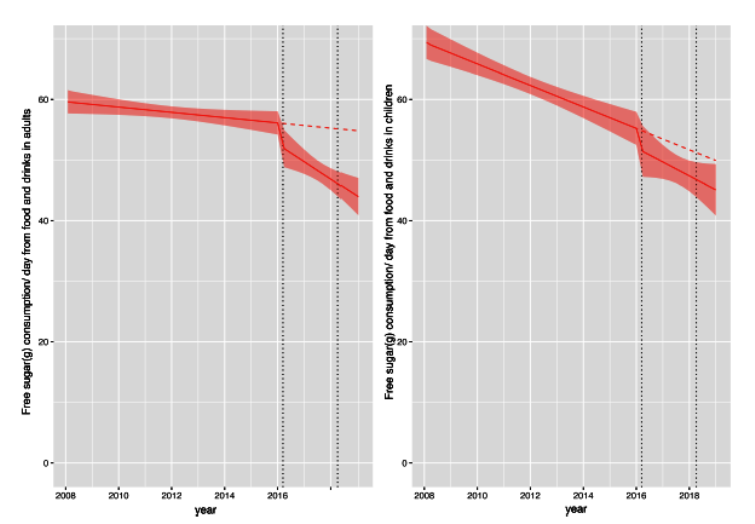
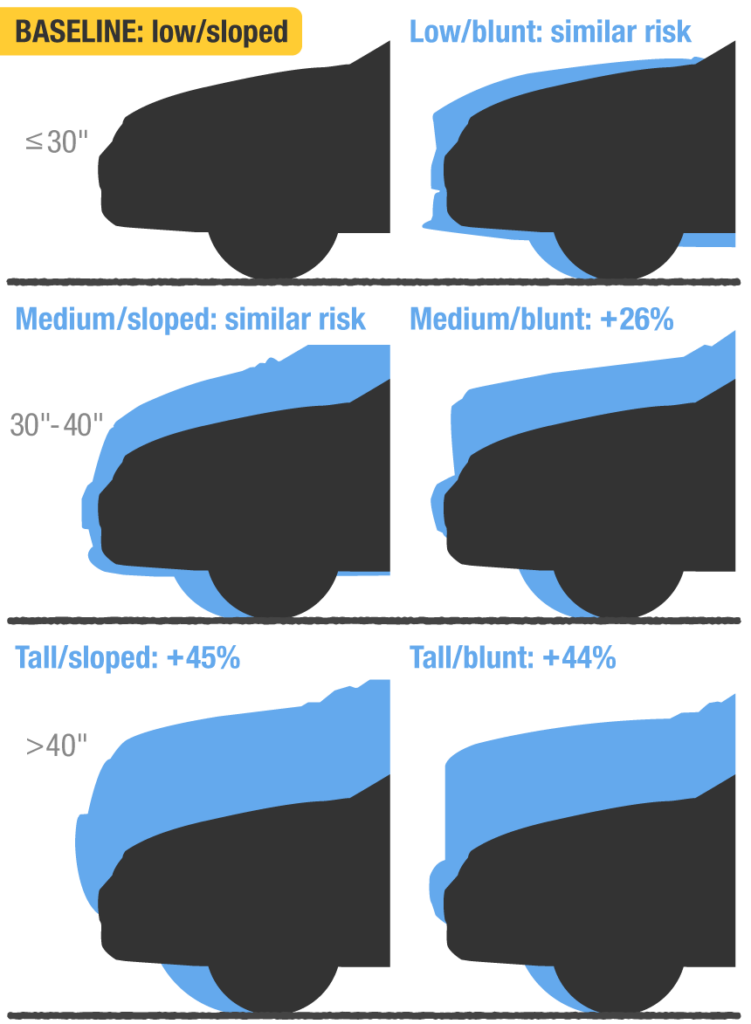
:focal(1280x850:1281x851)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/06/horw_von_oben-scaled.jpeg)
:focal(950x1022:951x1023)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/10/IMG_1304.jpg)
:focal(50x50:51x51)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2021/08/Portrait_Valeria_Wieser_klein.png)
:focal(50x50:51x51)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2014/06/imagescms-image-002882106.jpg)